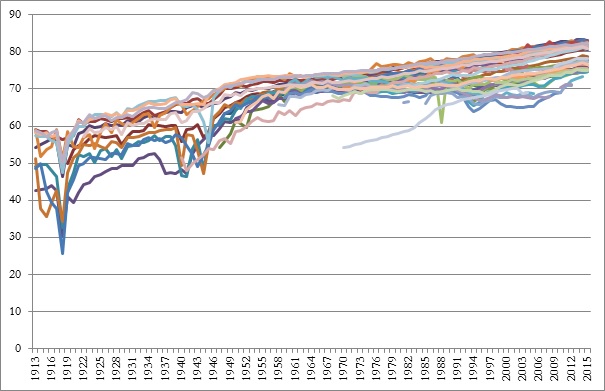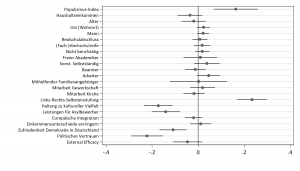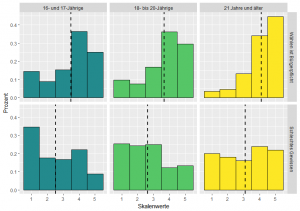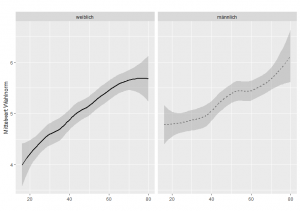von Achim Goerres
Dieser Beitrag erscheint auf Einladung in der nächsten Ausgabe von „Forum Kommunalpolitik“, einem Magazin für grüne KommunalpolitkerInnen. Die erste Publikation aus der beschriebenen Studie ist online frei verfügbar: Goerres, Achim, Hamidou, Hayfat, Baudisch, Alexander, Schmelzer, Maximilian, Tegeler, Shari and Rabuza, Florian: Die soziale, wirtschaftliche und politische Herkunft lokaler politischer Eliten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2015: Ergebnisse einer telefonischen Befragung von Mitgliedern aus zehn Gemeinde- und Stadträten (April 22, 2016). Verfügbar über das Social Science Research Network unter http://ssrn.com/abstract=2768691
Das Faszinierende an NRW- Kommunalpolitik ist die Nähe zwischen den politischen Problemen, den gewählten Mitgliedern der Räte und den Bürger*innen. Probleme sind greifbar und direkt für den Alltag von Vielen relevant. In solch einem Kontext kann es wünschenswert sein, dass die politischen Interessen der Bevölkerung in ihrer ganzen Vielfalt vertreten sind. Eine Möglichkeit, diese Repräsentation politischer Interessen herzustellen, ist die deskriptive Repräsentation:
politisch relevante Individualmerkmale der Repräsentierten spiegeln sich in den Merkmalen der Repräsentanten wider. Die persönlichen Merkmale, die tatsächlich die politischen Interessen der Bevölkerung bestimmen, werden über Wahlen in den Eigenschaften der Ratsmitglieder abgebildet.
Schnell kommt man aus solch einer Sichtweise bei den Eigenschaften „formelle Bildung“ und „Einkommen“ an. Niemand, der sich mit Politik in Deutschland auskennt, würde bestreiten, dass die sozialen Erfahrungen, die mit diesen Eigenschaften verbunden sind, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, die politischen Erwartungen zu beeinflussen. Man könnte die Liste erweitern, beispielsweise um Gender und Herkunft, was wir hier außer Acht lassen.
Wie sieht es dann mit der deskriptiven Repräsentation in NRW auf lokaler Ebene aus? Antwort gibt eine neue Studie, die ich zusammen mit meinen Mitarbeiter*innen und Studierenden an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt habe: Das politische Leben auf kommunaler Ebene in NRW im Jahr 2015. Diese Eliten-Studie („Elite“ wird wissenschaftlich neutral verwendet) beruht auf einer telefonischen Umfrage unter gewählten Mitgliedern der Gemeinde- und Stadträte aus NRW und ist für unser Bundesland einzigartig.
Dabei wurden in einem ersten Schritt zehn Räte ausgewählt, die alle denkbaren Kombinationen aus Bevölkerungsgröße und Steuerressourcen abdecken. Bei den zehn Kommunen handelt es sich um Vettweiß, Erndtebrück, Langerwehe, Burbach im Siegerland, Windeck, Verl, Leichlingen (Rhld.), Monheim am Rhein, Herne und Düsseldorf.
Innerhalb der zehn Gemeinden wurden alle 403 Mitglieder der Räte mehrmalig kontaktiert und um ein Interview gebeten. Dem voraus ging eine ausführliche Information der Bürgermeister, Fraktionen und Gruppen. Vollständig durchgeführt haben das Interview 165 Ratsmitglieder, also 41 %. Diese Datenbasis ist für solch eine Zielgruppe sehr hochwertig und repräsentativ für die Mitglieder aller NRW-Räte.
Grüne Befragte
Unter den Befragten befinden sich 16 Mitglieder der Bündnis 90/Grünen-Ratslisten aus 36 angefragten Mitgliedern. Damit sind die Daten für die Ratsmitglieder dieser Partei aller NRW-Räte ebenfalls – statistisch gesprochen – repräsentativ. Doch ist diese Teilgruppe für diese Parteiliste recht klein, weswegen man bei der Interpretation eine recht große Unsicherheit der Schätzung berücksichtigen muss. Im Folgenden werde ich jeweils die Ergebnisse für alle Mitglieder sowie gegliedert nach CDU, SPD und Bündnis‘90/Grüne berichten.
Die Ergebnisse zeigen insgesamt ganz klar, dass die kommunalen politischen Eliten in NRW noch nicht einmal annähernd in den Merkmalen Schulabschluss und persönlichem Einkommen deskriptiv-repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung sind.
Sozial und ökonomisch sind die gewählten Vertreter*innen ein verzerrtes Abbild der Bevölkerung zugunsten höherer Gesellschaftsschichten.
Dabei zeigen die Befunde für die drei Parteien einige Unterschiede, die man aufgrund der statistischen Unsicherheit nicht überbewerten sollte. Die Ergebnisse sind im Detail in der Tabelle dargestellt.
Bildung
Für die erwachsene NRW-Bevölkerung mit deutschem Pass als Vergleichsgruppe kann man entnehmen, dass 34 % einen Volks- oder Hauptschulabschluss haben, 26 % einen Realschulabschluss, 10 % über ein Fachabitur und 29 % über Abitur verfügen (1 % anderer Abschluss z.B. ausländischer).
Für alle kommunalen politischen Eliten gilt, dass 8 % einen Volks- oder Hauptschulabschluss haben, 18 % einen Realschulabschluss, 19 % ein Fachabitur und 53 % das Abitur (2 % anderer Abschluss). Wir sehen also ganz deutlich, dass mehr als die Hälfte der gewählten Politiker*innen auf lokaler Ebene über den höchsten Schulabschluss verfügen, eine Quote knapp doppelt so hoch wie für die allgemeine Bevölkerung.
Für Bündnis‘90/Grüne ist die Verzerrung zugunsten der höchsten Schulabschlüsse noch einmal deutlicher als für die kommunalen politischen Eliten allgemein. 69 % der B‘90/Grüne-Ratsmitglieder haben das Abitur, 25 % ein Fachabitur. Gewählte Ratsmitglieder mit niedrigeren Abschlüssen kommen in der Stichprobe überhaupt nicht vor und sind damit in der Gruppe aller Grünen sehr selten vertreten. Für die beiden anderen Parteien CDU und SPD gilt ebenfalls, dass etwa zwei Drittel Fachabitur oder höher haben. Die Ratsmitglieder von B‘90/Grünen sind in Bezug auf den Schulabschluss nicht nur nicht repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung, sie sind als Gruppe fast völlig bildungshomogen in dem Sinne, dass ihre Gruppenmitglieder nur hohe Schulabschlüsse besitzt.
Einkommen
Beim persönlichen Nettoeinkommen, also dem monatlichen Einkommen nach Steuern und Transfers sind für die NRW-Bevölkerung folgende Informationen bekannt, die dem bundesweiten Bild ähnlich sind: 48 % verdienen monatlich bis zu 1.300 €, 78 % bis zu 2.000 €, 94 % verdienen persönlich bis zu 3.500 €.
Für die kommunalen politischen Eliten insgesamt zeigt sich, dass Einkommensstärkere deutlich häufiger vertreten sind, als es aufgrund der Verteilung in der Bevölkerung bei einer völlig gleichen Repräsentation wäre. Nur 18 % der Mitglieder der Räte verdienen bis zu 1.300 €, 30 % verdienen bis zu 2.000 € und 75 % bis zu 3.500 €. 25 % verdienen mehr als 3.500 € netto, verglichen mit nur 4 % und NRW und 10 % für ganz Deutschland.
Für die drei Parteien zeigt sich, dass die Einkommensverzerrung für B‘90/Grüne am schwächsten ist. Hier finden sich beispielsweise in der höchsten Einkommensgruppe nur 13 % im Vergleich zu 29 % und 30 % bei jeweils CDU und SPD. Die stärkste Einkommensuntergruppe der B’90/Grüne-Mitglieder ist in der Gruppe zwischen 2.000 und 2.900 € mit 38 %. Aber selbst für diese Partei ist die Einkommensgruppe bis zu 1.300 € mit 25 % nur halb so groß wie in der Bevölkerung. Darunter fällt allerdings auch ein relativ großer Teil von Personen, die sich noch in der Ausbildung befinden also die Spitze ihres Einkommens noch vor sich haben.
In Summe zeigt sich also, dass die kommunalen gewählten PolitikerInnen der B‘90/Grüne insgesamt ebenfalls eine sozial und ökonomisch hochverzerrte Gruppe im Vergleich zur Bevölkerung darstellen. Im Bereich der Schulabschlüsse ist die Verzerrung so stark, dass untere Schulabschlüsse gar nicht mehr vorkommen.
Nun sind diese Befunde über die kommunalen Abgeordneten in ganz NRW nicht überraschend. Seit Erscheinen der Studie berichten mir Experten der Kommunalpolitik aus Verwaltung, Politik und Journalismus ähnliche Erfahrungen aus ihrem Umfeld. Aber es ist ein Unterschied, ob in einer objektiven wissenschaftlichen Studie solche Befunde nachgewiesen werden oder ob man diese nur aus der eigenen anekdotischen Erfahrung kennt.
Wenn man eine rein meritokratische Perspektive auf Fähigkeiten und Politik hat, sind diese Befunde interessant, aber irrelevant. Ehrenamtliche Politik ist hier Organisation, Kommunikation und Hartnäckigkeit, Fähigkeiten, die Menschen aufgrund einer Reihe von Faktoren in unterschiedlicher Ausprägung haben.
Aus Sichtweise der deskriptiven Repräsentation sind die Befunde katastrophal. Aus dieser Sicht sollten alle politischen Parteien einen sozialen und ökonomischen Querschnitt der Bevölkerung in den Reihen ihrer Aktiven haben. Nur damit können sie die großen Probleme vor Ort erfassen und bearbeiten.
Um dies zu erreichen, muss der Zugang zu Partei und kommunalen Wahllisten so niedrigschwellig wie möglich sein. Das bedeutet auch, dass man unbewusste Formen der Bevorzugung von bestimmten Personen wahrnimmt. Wir alle neigen dazu, uns mit ähnlichen Menschen im sozialen Umfeld zu umgeben. Diese Tendenz darf nicht im politischen Umfeld unbewusst angewandt werden, sonst rekrutieren die jetzigen politischen Eliten weiter Leute wie sie selbst in die relevanten Positionen von morgen.
Tabelle über Verteilung von Schulabschluss und persönlichem Nettoeinkommen in der Bevölkerung und den kommunalen politischen Eliten
|
Allgemeine NRW-Bevölkerung
|
Kommunale politische Eliten
|
Bündnis90/ Die Grünen
|
CDU
|
SPD
|
| Schulabschluss |
|
|
|
|
|
| Volks- / Hauptschulabschluss |
34%
|
8%
|
–
|
17%
|
4%
|
| Realschulabschluss |
26%
|
18%
|
–
|
17%
|
30%
|
| Fachhochschulreife |
10%
|
19%
|
25%
|
15%
|
20%
|
| Abitur |
29%
|
53%
|
69%
|
50%
|
46%
|
| Sonstiger Schulabschluss |
1%
|
2%
|
6%
|
2%
|
–
|
| Einkommen |
|
|
|
|
|
| Bis 1300€ |
48%
|
18%
|
25%
|
13%
|
7%
|
| 1300€ – 2000€ |
30%
|
12%
|
13%
|
10%
|
16%
|
| 2000€ – 2900€ |
12%
|
28%
|
38%
|
32%
|
27%
|
| 2900€ – 3500€ |
6%
|
18%
|
13%
|
16%
|
20%
|
| Über 3500€ |
4%
|
25%
|
13%
|
29%
|
30%
|
Quellen: eigene Schätzungen aus dem Allbus 2014 und der beschriebenen Studie.